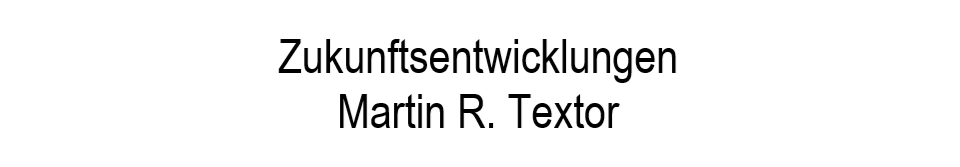Zukunftstrends: Wirtschaft
Wirtschaftsentwicklung
Bedingt durch den Übergang zur Wissensgesellschaft und den sich weiter beschleunigenden technischen Fortschritt wird die Wirtschaft immer mehr durch Forschung und Entwicklung, wissenschaftliche Erkenntnisse und neue Technologien geprägt. Auch werden die Produktzyklen immer kürzer: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts dauerte der Weg von der Idee über die Erfindung bzw. das Patent bis hin zur Massenproduktion 40 Jahre; Mitte des 20. Jahrhunderts waren es 30 Jahre; heute sind es nur noch 6 Monate und bei manchen Produkten sogar gerade einmal 6 Wochen. Gründe für die rasante Verkürzung von Produktionszyklen sind beispielsweise die Nutzung von Computern mit besseren Leistungen, die Zusammenarbeit via Internet, die „schlanke Produktion“, innovative Herstellungsverfahren und die weltweite technologische Kooperation. Zudem müssen immer wieder neue Produkte auf dem Markt platziert werden, da sie immer schneller von der Konkurrenz kopiert und vielleicht sogar billiger angeboten werden. Unternehmen, die einen Technologiesprung verpassen, werden innerhalb weniger Monate von ihren Wettbewerbern überholt.
In den Jahren 1994 bis 2020 lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statista bei maximal 2,6% – in den Jahren 2013 bis 2020 sogar bei unter 2%. Der Geldwert galt somit als stabil. Bedingt durch die Lockdowns während der Corona-Pandemie, die aufgrund des Ukrainekrieges verhängten Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland und den als Reaktion darauf erfolgenden weitgehenden Lieferstopp von russischem Gas kam es in Deutschland zu einem rasanten Anstieg der Inflation: Sie nahm von 0,5% im Jahr 2020 auf 3,1% im Jahr 2021 zu und stieg im Jahr 2022 auf 6,9% sowie im Jahr 2023 auf 5,9%. Im Jahr 2024 sank die Inflationsrate wieder auf 2,2%.
Parallel dazu kam es zu einer Verlangsamung der Wirtschaftsentwicklung: Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP), das 2021 und 2022 laut Statistischem Bundesamt noch um 3,9% bzw. 1,9% gestiegen war, sank 2023 um 0,7% und 2024 um 0,5% – es kam zu einer Rezession, die 2025 andauert und sich in den kommenden Jahren noch verschärfen könnte, da der US-Präsident Donald Trump deutsche Waren mit hohen Zöllen belegt hat. Insbesondere die Industrieproduktion nahm stark ab, ohne dass ein Ende dieser Entwicklung zu erkennen ist: Sie lag laut dem Wallstreet Journal im Jahr 2024 um fast 20% unter dem Höchststand von 2017. Die Prognose für die kommenden Jahre ist eher negativ: Wegen der vergleichsweise hohen Energiekosten, Löhne, Lohnnebenkosten und Steuern, wegen der vielen Vorschriften, der überbordenden Bürokratie, der schlechten Infrastruktur, der Lieferengpässe, des Fachkräftemangels und des steigenden Krankenstandes – der laut Statistischem Bundesamt von 9,5 Tagen im Jahr 2013 auf 15,1 Tage im Jahr 2023 zunahm – investieren immer mehr Unternehmen lieber im Ausland als in Deutschland. Dabei werden in erster Linie Tochterfirmen gegründet, anstatt dass wie in den USA und anderen Ländern in Digitalkonzerne, Biotech-Unternehmen oder hochwertige Dienstleistungen investiert wird. Zudem schwächelt der Konsum in Deutschland, ist die Auftragslage miserabel, gehen die Exporte zurück. In den kommenden Jahren ist also mit mehr Kurzarbeit, einem Rückgang der Beschäftigten in der Wirtschaft, mit vielen Insolvenzen und mit Betriebsschließungen zu rechnen. Falls die Politik nicht in nächster Zeit die Rahmenbedingungen verbessert, könnte es im Extremfall bis 2050 zu einer Deindustrialisierung Deutschlands kommen.
Laut der ifo-Konjunkturumfrage vom Oktober 2024 fürchteten bereits 7,3% der befragten Unternehmen um ihre Existenz. Wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ermittelte, gaben in diesem Jahr 196.100 Unternehmen auf – 16% mehr als 2023. Einer Befragung von Infratest Dimap zufolge machten sich im Dezember 2024 schon drei Viertel aller Deutschen sehr große oder große Sorgen um den Wirtschaftsstandort Deutschland – und 21% der erwerbstätigen Befragten hatten Angst um ihren Arbeitsplatz. Diese Sorge wird in den kommenden Jahren noch zunehmen: So ist die Zahl der Arbeitslosen laut Bundesagentur für Arbeit im Januar 2025 auf 2,99 Millionen gestiegen und war damit so hoch wie seit 2015 nicht mehr.
Ähnliche Gründe wie in Deutschland verlangsamten auch die Wirtschaftsentwicklung in der EU. Während sie 2010 bei der Wirtschaftsleistung noch auf dem gleichen Niveau wie die USA war, erreicht die amerikanische Wirtschaft laut der Zeitung Welt nun rund 50% mehr Wertschöpfung. Da die meisten Zukunftstechnologien in den USA entwickelt werden, dürfte sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen.
Von der Globalisierung zur De-Globalisierung
In den letzten Jahrzehnten ist es zu einer Globalisierung der Wirtschaft gekommen: Immer mehr Unternehmen operieren in immer mehr Ländern; ihre Produkte können nun weltweit erworben werden. Produktionsstandorte wurden dorthin verlagert, wo die besten Rahmenbedingungen bestehen; Vorprodukte werden aus Ländern bezogen, wo sie besonders preiswert hergestellt werden können. Es entstanden international operierende Unternehmen, die eine größere Wirtschaftskraft als manche Länder haben. Die Politik hat der zunehmenden multinationalen Konzernmacht immer weniger entgegenzusetzen. Allerdings schwächt sich die Globalisierung seit zwei, drei Jahren aufgrund von Handelskonflikten und protektionistischen Bestrebungen einzelner Regierungen ab. Die seit dem Jahr 2020 auftretenden Lieferengpässe, die Industrie, Handwerk und Handel betreffen, könnten die De-Globalisierung beschleunigen.
In den kommenden Jahren werden alte und neue Wirtschaftsmächte miteinander wetteifern. Schon jetzt fließen die Kapitalströme in beide Richtungen, kaufen chinesische, indische oder mexikanische Unternehmen nordamerikanische bzw. europäische Firmen auf. Auch geht die Zeit zu Ende, in der multinationale Unternehmen in den Schwellenländern hauptsächlich einfache Arbeiten zu geringen Kosten ausführen ließen. So produzieren Länder wie China, Südkorea oder Taiwan immer mehr hochwertige Güter, geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus und verfügen über gut ausgebildete Fachkräfte. Hochtechnologiestandorte und Innovationszentren sind inzwischen über den ganzen Globus verbreitet.
Laut einer Studie von Fritz Breuss, Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, wird Europa seinen gegenwärtigen Weltmarktanteil nicht verlieren – trotz der von Wirtschaftsvertretern kritisierten hohen Sozialstandards und niedrigen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Dazu würde der stetig wachsende Binnenmarkt beitragen, in dem rund drei Viertel des gesamten Handels stattfinden (inkl. assoziierter Staaten, von EFTA und Türkei). Der Erfolg der EU beruht laut Breuss auf der Ausweitung des Binnenhandels und auf der Abfederung sozialer Härten. Jedoch würde durch die Globalisierung weiter Druck auf die Löhne ausgeübt werden.
Aber auch außerhalb der EU werden sich neue Chancen ergeben. So bieten Schwellenländer einem Technologie- und Exportland wie Deutschland immer größer werdende Märkte, auf denen es seine Güter verkaufen kann. Dies gilt insbesondere für China: Die Volksrepublik war 2023 bereits im achten Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner; laut dem Statistischen Bundesamt wurden Waren im Wert von 254,4 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt (Summe der Exporte und Importe). Die Handelsbeziehungen zu anderen Schwellenländern sind aber noch relativ unbedeutend: Beispielsweise summierten sich die Importe und Exporte im Handel mit Indien auf gerade einmal 30,8, mit Mexiko auf 29,1, mit Südafrika auf 21,9 und mit Brasilien auf 21,1 Milliarden Euro. Das ist relativ wenig, denn der Gesamtwert der deutschen Exporte lag 2023 bei 1.590 Milliarden Euro (+0,3% gegenüber 2022) und der der Importe bei 1.366 Milliarden Euro (+9,3%). Die meisten Exporte gingen in die USA, Frankreich, die Niederlande und Polen; die meisten Importe kamen aus China, den Niederlanden, den USA, Polen und Italien. Kraftwagen und Kraftwagenteile waren mit 270 Milliarden Euro Deutschlands wichtigstes Exportgut, gefolgt von Maschinen im Wert von 225 Milliarden Euro und chemischen Erzeugnissen im Wert von 141 Milliarden Euro. Problematisch ist jedoch, dass sich derzeit das Exportgeschäft auf einige wenige Branchen – insbesondere die Autoindustrie und den Maschinenbau – konzentriert.
Die 100 größten deutschen Unternehmen erzielten rund 60% der Umsätze im Ausland; bei den Maschinenbauern waren es sogar vier Fünftel. Sehr erfolgreich auf dem Weltmarkt sind aber auch mittelständische Unternehmen, die flexibler reagieren können als börsennotierte. Zudem können sie langfristig investieren, müssen in ihren Bilanzen nicht immer große Gewinne ausweisen – und können in Deutschland ähnlich günstig produzieren wie in Asien, da dort die Löhne für gut qualifizierte Fachkräfte stark angestiegen sind. Rund 1.300 Unternehmen sind in ihrer Nische Weltmarktführer – fast die Hälfte aller „Hidden Champions“ befindet sich in Deutschland. Mittelständischen Unternehmen gelingt es auch immer besser, sich durch eigene Niederlassungen, neue Vertriebspartner und Joint-Ventures weitere Märkte zu erschließen.
Allerdings zeigt sich die Globalisierung auch darin, dass ausländische Investoren einen immer größeren Anteil an den Aktien deutscher Unternehmen besitzen. Laut Handelsblatt gehörten mindestens 53% der Aktien von DAX-Konzernen im Jahr 2021 Ausländern bzw. ausländischen Fonds, die somit zunehmend Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen gewinnen und einen großen Teil der Dividenden erhalten. Dies hängt damit zusammen, dass Deutsche seltener in Aktien (-fonds) investieren als Menschen in anderen hoch entwickelten Ländern. Da sich andere Geldanlagen aufgrund der niedrigen Zinsen kaum noch rentieren, steigen auch die Privatvermögen in diesen Ländern stärker an als in Deutschland.
Jedoch könnte die Globalisierung in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren. So könnte es aufgrund der höher werdenden Löhne in den Schwellenländern und der steigenden Rohstoffpreise (insbesondere für Erdöl) in den kommenden Jahrzehnten zu einer Regionalisierung in der Wirtschaft kommen: Wenn die Herstellungskosten in fernen Ländern und die Transportkosten zu hoch werden, wird Insourcing das Outsourcing ersetzen. Dasselbe gilt für den Fall, dass in hoch entwickelten Ländern die Herstellung von Gütern durch Automatisierung und künstliche Intelligenz preiswerter als in Niedriglohnländern wird. Ganze Produktionszweige werden dann wieder an die Verbrauchsorte zurückgeholt werden; die ausgelagerten Jobs werden zurückkehren.
Zudem haben die letzten Jahre gezeigt, wie leicht Lieferketten zerfallen, wenn Länder sich abschotten (z.B. Einreiseverbote und Schließung von Häfen während der Corona-Pandemie), es zu längeren Lockdowns in wichtigen Industrieregionen kommt (z.B. wie in Shenzhen, Xi'an und Shanghai), die Ausfuhr bestimmter Güter verboten wird oder Importe aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen bzw. Sanktionen ausbleiben (Ukraine-Krieg). Viele Unternehmen werden daraus die Lehre ziehen, die in andere Länder verlagerten Produktionsbereiche zurückzuholen bzw. die dort von anderen Unternehmen produzierten Vorprodukte selbst herzustellen. Zudem werden Regierungen darauf bestehen, dass wichtige Produkte – wie z.B. bestimmte Medikamente oder Schutzkleidung – im eigenen Land produziert werden.
Schließlich nehmen insbesondere in den USA und in der EU protektionistische Bestrebungen zu, soll der Marktzugang vor allem für chinesische Produkte erschwert werden. Dies könnte aber auch dazu führen, dass China vermehrt in den USA und in der EU investieren wird (oder europäische Staaten in den USA), also dort z.B. Fabriken errichtet. Wie früher in China könnte es wieder zu Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen kommen, nun aber an europäischen oder amerikanischen Standorten. Davon könnten z.B. deutsche Autohersteller profitieren, deren Produkte oft nicht mehr auf dem neusten technischen Stand sind.
Gleichzeitig wächst in der deutschen Bevölkerung die Skepsis hinsichtlich der Globalisierung: Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft waren 2020 nur noch 48% der befragten 30- bis 59-Jährigen der Meinung, dass die deutsche Wirtschaft von der Globalisierung vor allem profitiere – im Jahr 2017 waren es noch 64% gewesen.
Zukunftsbranchen
Will Deutschland auf dem Weltmarkt bestehen, muss es sich in Richtung eines „kreativen Kapitalismus“ (Matthias Horx) weiterentwickeln. Das verlangt mehr Forschung und Entwicklung, mehr Ideenreichtum und Innovation, mehr Bildung und Weiterqualifizierung. Vor allem aber muss auf Branchen mit Zukunft gesetzt werden.
Dazu gehört z.B. der Umweltsektor. Im Jahr 2022 waren laut Statistischem Bundesamt 376.000 Menschen in diesem Bereich tätig und machten 107,5 Milliarden Euro Umsatz mit Gütern und Leistungen für den Umweltschutz. Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen, da die Nachfrage nach umweltschutzorientierten Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien und energetische Gebäudesanierung, noch zunehmen dürfte.
Als eine weitere Zukunftsbranche gilt die Biotechnologie, die eine immer größere Rolle in der Industrie, in der Landwirtschaft und im Gesundheitswesen spielen wird. Nach einer OECD-Studie könnte sie im Jahr 2030 bis zu 2,7% des Bruttoinlandsprodukts in den Industrieländern und einen noch größeren Anteil in den Entwicklungsländern ausmachen (heute: unter 1%) – falls Barrieren wie rechtliche Hemmnisse, fehlende Investitionen, mangelnde soziale Akzeptanz usw. beseitigt würden.
Auch die Agrarchemiebranche sieht ihre Zukunft positiv. Da die Weltbevölkerung bis 2030 um 40% gegenüber 1995 wachsen wird, muss im gleichen Zeitraum die Getreideproduktion um 50% zunehmen. Dies ist laut der Welternährungsorganisation (FAO) nur möglich, wenn beim Anbau 37% mehr Mineraldünger eingesetzt werden. Der Industrieverband Agrar (IVA) rechnet in den kommenden Jahren mit Rekordumsätzen bei Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut.
Mitbedingt durch das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Urbanisierung, aber auch zwecks Schaffung eines modernen Energienetzes, haben Infrastrukturprojekte eine große Zukunft – also Investitionen in Straßen, Flughäfen, Telekommunikation, Kanalisation, Strom- und Wasserversorgung. Die OECD taxiert den weltweiten Investitionsbedarf bis 2030 auf 70 Billionen $.
Eine entsprechende Infrastruktur wird auch für die weiter zunehmende Zahl von Autos benötigt werden. Der Shell-Konzern erwartet, dass sich der globale PKW-Bestand von derzeit 700 Millionen Fahrzeugen bis 2030 verdoppeln und bis 2050 sogar auf mehr als 2 Milliarden PKWs ansteigen könnte. So wird die Automobilindustrie in Deutschland boomen. Allerdings produzieren die hiesigen Konzerne und ihre Zulieferer zunehmend in den Ländern, in denen die meisten Käufer zu finden sind, da dann die Transportkosten wegfallen. Auch nimmt die Konkurrenz zu, da immer mehr preiswerte PKWs von Herstellern aus China, Indien und anderen Schwellenländern produziert werden. Zudem ist die deutsche Automobilindustrie in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren gegenüber amerikanischen und ostasiatischen Konzernen zurückgefallen.
Die Weltraumwirtschaft gilt ebenfalls als eine Zukunftsbranche: Insbesondere in den USA ist die kommerzielle Raumfahrt stark ausgebaut worden. Sie übernahm weitgehend den Transport von Kommunikations- und Fernsehsatelliten sowie die Versorgung der Internationalen Weltraumstation (ISS). In der nahen bzw. fernen Zukunft wird es z.B. Weltraumtourismus, Flüge zum Mars und Rohstoffgewinnung auf dem Mond und einzelnen Asteroiden geben.
In den kommenden Jahren wird auch der Designwirtschaft eine immer größere Bedeutung zukommen. Hier stellen 3D-Drucker Gegenstände her, indem sie nach einem vorgegebenen Design Schicht auf Schicht aufeinander drucken und dabei die in den Druckerpatronen vorhandenen Kunststoffe, Metalle und sonstigen Materialien nutzen. Sie können bereits Bestandteile von Motoren, Ersatzteile von Maschinen, Prothesen, Zahnimplantate, Architekturmodelle, Prototypen, Skulpturen und viele andere Gegenstände herstellen. Einer Studie des Marktforschungsinstituts Allied Market Research zufolge erwirtschafteten Unternehmen 2020 weltweit einen Umsatz von circa 13,2 Milliarden $ mit 3D-Druck. Für das Jahr 2030 wird ein Umsatz von 90 Milliarden $ prognostiziert.
3D-Drucker können von Privatleuten bereits für wenige hundert Euro erworben werden. Bei einem solchen Preis könnte die „Fabrik im Wohnzimmer“ Realität werden. So wird erwartet, dass in ca. 20 Jahren die meisten Privathaushalte 3D-Drucker haben und damit Kleidung, Spielsachen, Ersatzteile, Modeschmuck u.a. selbst herstellen werden. Die Designs können entweder gekauft oder mit Hilfe von CAD-Software erstellt werden. Im letztgenannten Fall können ganz individuelle Produkte hergestellt werden. Selbst wenn die Druckerpatronen relativ teuer sind, könnte doch viel Geld gespart werden, weil weniger Material und Energie benötigt werden (z.B. keine Verpackung, kein Transportkosten). Auch Menschen in ärmeren Länder könnten mit 3D-Druckern Gegenstände billig herstellen – oder Designs entwickeln und verkaufen.
Eine große Zukunft wird der Informations- und Kommunikationstechnologie vorausgesagt. Im Jahr 2022 waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 130.517 Unternehmen mit 1,6 Millionen Erwerbstätigen auf diesem Gebiet tätig. Sie erwirtschafteten 350 Milliarden Euro.
Klassisches E-Commerce wird in Zukunft gegenüber Social Commerce an Bedeutung verlieren – der Orientierung an erfahrenen Online-Nutzern, die nicht in irgendwelchen Katalogen herumklicken wollen, sondern auch im Internet nach Shopping-Erlebnissen, Spaß und sozialer Interaktion suchen. Amazon und Ebay haben gezeigt, wie man User aktiv einbinden kann; andere Web-Unternehmen bauen jetzt darauf auf. So werden in Zukunft vor allem solche Verkaufskonzepte erfolgreich sein, die den Austausch zwischen Usern, Konsumenten und Produzenten fördern. Durch den nutzergetriebenen Handel wird ein digitaler „Weltbasar“ entstehen.
Da das Internet eine zunehmende Zahl kleiner und kleinster Märkte umfasst, wird es für Unternehmen immer wichtiger, die Treue von Kunden zu erlangen, damit diese weiterhin auf ihrer Website einkaufen und diese weiterempfehlen. Hingegen wird es immer schwieriger werden, neue Kunden zu gewinnen, werden einmalige Käufe an Bedeutung verlieren. Deshalb werden Unternehmen zunehmend interaktive Elemente in ihre Websites einbauen, Anfragen schnell beantworten, Kundenkommentare integrieren, Newsletter verschicken sowie nach Einkäufen E-Mails mit der Bitte um Feedback versenden. Zudem werden sie immer häufiger versuchen, auch unabhängig von ihrer Website im Internet präsent zu sein und die Diskussion über ihre Produkte in sozialen Netzwerken, Blogs und Online-Foren zu beeinflussen. Sie werden anderen Websites Artikel oder Videos zur Verfügung stellen und dort Werbung schalten. Schließlich werden immer mehr Unternehmen und Händler Online-Marktplätze nutzen, wie sie z.B. von Amazon zur Verfügung gestellt werden.
Im Jahr 2021 wurden laut Handelsverband Deutschland (HDE) Waren im Wert von 87 Milliarden Euro vom Einzelhandel auf dem Versandweg verkauft (E-Commerce) – 20% mehr als im Vorjahr. Rund 65% der Deutschen kauften in diesem Jahr online ein. Dementsprechend nimmt der LKW-Verkehr zu: Alleine die Deutsche Post lieferte 2021 mehr als 1,8 Milliarden Pakete aus. Das Transportwesen wird auch in den kommenden Jahren ausgebaut werden, zumal viele Unternehmen eine Lieferung am selben Tag anstreben. Dann könnten z.B. auch (frische) Lebensmittel versendet werden.
In Deutschland und anderen hoch entwickelten Ländern werden sich Unternehmen zunehmend auf die wachsende Konsumentengruppe der Senioren einstellen. Schon heute stammt jeder dritte Euro, der in Deutschland privat ausgegeben wird, von einem Menschen über 60 Jahre; 2050 werden es mehr als 40% sein. Die Wirtschaft interessiert sich vor allem für die „Best Ager“, die relativ fitten, meist gut situierten Senioren. Diese dürften in Zukunft mehr Geld für Unterhaltung, Bildung, Kultur, Reisen, Wellness sowie Gesundheits-, Finanz- und Versicherungsleistungen ausgeben. Beispielsweise wird die Versicherungsbranche mehr spezielle Senioren-Policen verkaufen, über die bei einem Unfall oder einem sonstigen Unterstützungsbedarf bestimmte Dienstleistungen wie z.B. Kochen, Einkäufe und Wohnungsreinigung finanziert werden.
Die Industrie entwickelt immer häufiger Produkte, die den Bedürfnissen von Senioren angepasst sind. So baut die Automobilindustrie zunehmend Funktionen wie rückenfreundliche Sitze oder Fahrerassistenzsysteme in PKWs ein, während die Bauindustrie ebenerdige Bungalows erstellt und vorhandene Wohnungen von Barrieren befreit. Hightech-Geräte werden von vielen Senioren nur dann gekauft werden, wenn sie sich leicht bedienen lassen – also z.B. gut lesbare Displays und große Tasten haben. Auch benötigen Senioren immer mehr medizinische Geräte und Hilfsmittel.
Um die Versorgung von (älteren) Menschen in bevölkerungsarmen Regionen sicherzustellen, werden (neue) Betriebs- und Vertriebsformen – wie die Bündelung verschiedener Serviceleistungen, Kioske, Kleinstmärkte, mobile Verkaufswagen oder Bringdienste – entwickelt werden. Auch benötigen viele Senioren Essens-, Reinigungs- und Betreuungsdienste. Mehr soziale Dienstleistungen als heute werden privat (z.B. auf Gegenseitigkeit) oder privatwirtschaftlich organisiert sein.
Schließlich werden mehr Seniorenheime, ambulante Dienste sowie geriatrische und gerontopsychiatrische Abteilungen in Krankenhäusern benötigt. So wird sich die Zahl der Heimplätze bis 2050 nahezu verdreifachen – auf rund 2 Millionen. Der Grund für diese Entwicklung ist die wachsende und besonders häufig auf Hilfe angewiesene Altersgruppe der über 80-Jährigen, die im Jahr 2050 fast dreimal so groß sein dürfte wie 2005. Da die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2050 stark ansteigen wird, dürfte der Pflegebereich zu einem „Jobmotor“ werden: Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten soll laut einer Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft von 545.000 auf bis zu 1,6 Millionen im Jahr 2050 ansteigen. Unter Berücksichtigung einer jährlichen Produktivitätssteigerung von 0,5% wären es immerhin noch 1,2 Millionen Pflegejobs.
Jüngere Menschen werden vermutlich mehr Geld für die individuelle Gesundheitsprävention ausgeben: Hier wächst z.B. die Nachfrage in den Bereichen Wellness, Entspannungstechniken, Stressmanagement, Gesundheitstourismus, Bioprodukte und Nachsorge. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger könnten in der Gesundheitswirtschaft bis 2030 rund 2 Millionen Jobs neu geschaffen werden. Während 2005 etwa jeder Siebte in diesem Bereich beschäftigt war, wird es dann jeder Fünfte sein. Der Anteil der Gesundheitswirtschaft am Bruttoinlandsprodukt könnte von derzeit 10% auf fast 13% wachsen. Die Kosten für den Gesundheitsmarkt würden bis 2030 um 67% zunehmen.
In der Freizeitindustrie gelten z.B. Fitnessangebote für junge Erwachsene und Singles, Kurzurlaube für kinderlose Paare, Tagesausflüge für Familien sowie Kreuzfahrt-, Themenpark- und Städtetourismus als Wachstumsbereiche. Schon heute investieren die Deutschen jährlich 250 Milliarden Euro in ihre Freizeitgestaltung – zwischen 10 und 20% ihres Haushaltseinkommens. Vermutlich werden immer mehr künstliche Erlebniswelten geschaffen werden, wird es mehr inszenierte Kultur (z.B. Musikfestivals, Events, besondere Kunstausstellungen) und mehr Massenkultur geben.
Auch in 20 Jahren werden Pauschalreisen, Ferntourismus oder die Kombination von Billigflug und Luxushotel üblich sein, wobei die Preise zuvor im Internet abgeglichen werden und dort zunehmend gebucht wird. Außerdem wird immer mehr auf Urlaubsberichte in sozialen Netzwerken und auf Bewertungen von Reiseanbietern zurückgegriffen. Wellnessreisen werden häufiger – und preiswerter – sein. Ähnliches dürfte für den Ökotourismus gelten – und den „Voluntourism“, bei dem soziales Engagement im Urlaub gezeigt wird (z.B. Arbeitseinsätze in Behinderteneinrichtungen oder in Entwicklungsländern). Mehr Touristen als heute werden das extreme Abenteuer suchen oder ein Computerspiel bzw. einen Agenten-Thriller nachspielen wollen. Zudem wird die reale Urlaubswelt zunehmend durch eine virtuelle ergänzt werden. Allerdings wird es auch mehr Nichtreisende (aus Geldnot) und Sparreisende geben.
Laut dem Institut für Tourismus- und Freizeitforschung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Chur wird sich die touristische Nachfrage der über 65-Jährigen bis 2050 vervierfachen. Darunter werden arme und reiche Rentner, gesunde und kränkelnde Personen, lebenslange Partner sowie Todesfall- oder Scheidungs-Singles sein. Die Senioren würden sich keinen reinen Erholungsurlaub wünschen, da sie sich das ganze Jahr hindurch der Gesundheit widmen können, sondern werden nach Kulturgenuss, nicht alltäglichen Bildungsangeboten bzw. unbeschwerter Geselligkeit suchen. Daneben gäbe es Senioren, die alles bereist und erlebt haben und nun Urlaubsquartiere auswählen, wo sie sich „daheim“ fühlen, und Rentner, die an Urlaubsziele ihrer Kindheit zurückkehren möchten – oft in Gesellschaft ihrer Enkel. Die Angebote der Hotels und Reiseanbieter müssten alle Typen älterer Touristen berücksichtigen.
In Zukunft wird auch die Schattenwirtschaft weiterhin eine große – oder vielleicht noch größere – Rolle spielen. Bedingt durch die steigende Steuer- und Abgabenlast werden z.B. Handwerkerleistungen für viele Menschen zu teuer bzw. können Handwerker schwarz mehr verdienen. In der Schattenwirtschaft werden außerdem viele arbeitslose Menschen und Bürgergeldempfänger ein Zusatzeinkommen finden, zumal Sozialleistungen aufgrund der zunehmenden Zahl der Rentenempfänger bzw. Pflegebedürftigen und der wachsenden Staatsverschuldung tendenziell sinken dürften. Laut einer Studie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen macht in Deutschland die Schwarzarbeit derzeit (2024) 11,3% des Bruttoinlandsprodukts aus - 8,4% mehr als im Vorjahr.
Wettbewerbsfähigkeit
Die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird zu einem großen Teil von der Innovationsfähigkeit der Unternehmen abhängen. Diese lässt sich z.B. anhand der Zahl der Patentanmeldungen je 1 Million Einwohner ermitteln. Laut der World Intellectual Property Organization, einer UN-Behörde, kam Deutschland 2023 mit 751 inländischen Patentanmeldungen (2013: 917 Patente) auf den sechsten Platz – nach Südkorea mit 3.696, Japan mit 1.839, der Schweiz mit 1.212, China mit 1.079 und den USA mit 824 Patentanmeldungen. Es fällt auf, dass der Abstand Deutschlands zu den ersten drei Plätzen recht groß war. Unternehmen und Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik (und in anderen EU-Staaten) sind also nicht besonders kreativ und innovativ gewesen.
In den letzten Jahren stiegen in Deutschland die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stark an; allein im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt 129,7 Milliarden Euro (2015: 88,8 Milliarden Euro) und damit 3,1% des Bruttoinlandsprodukts investiert. Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Laut Stifterverband fließen aber rund 40% der FuE-Ausgaben in die Autoindustrie mit ihren Zulieferern – ein „alter“ Industriezweig, der immer mehr unter dem Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen leidet (wie auch der Maschinenbau) und den Übergang zum Elektroauto verpasste. Allerdings ist die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft nicht nur von entsprechenden Investitionen abhängig, sondern auch von Faktoren wie z.B. der Qualität des Bildungssystems, der Gründerkultur und dem vorhandenen Wagniskapital. Solche und ähnliche Faktoren werden im „Global Innovation Index“ berücksichtigt. Im Jahr 2023 lag Deutschland auf Platz 8 – nach der Schweiz, Schweden, den USA, Großbritannien, Singapur, Finnland und den Niederlanden. China kam auf den 12. und Japan auf den 13. Platz.
Dennoch hat in den letzten Jahrzehnten der Zuwachs an Produktivität je Arbeitsstunde in Deutschland stark abgenommen – laut Statistischem Bundesamt von über 3,5% in den 1970er Jahren auf 0,5% im Jahr 2022. Ein Jahr später wurde mit -0,6% sogar ein negativer Wert erreicht. Ursachen könnten beispielsweise der Eintritt weniger qualifizierter Arbeitnehmer in die Arbeitswelt (z.B. von Zuwanderern), eine strukturelle Verschiebung weg von hochproduktiven Wirtschaftsbereichen (z.B. Industrie) hin zu Bereichen mit geringerer Produktivität (z.B. Dienstleistungen) sowie die zunehmende Bedeutung der nur schwer messbaren immateriellen Wertschöpfung sein (z.B. digitale Wissens- und Datenökonomie).
Seit einigen Jahren nimmt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ab: Beim „World Competitiveness Ranking“ ist Deutschland zwischen 2020 und 2024 von Platz 17 auf Platz 24 gefallen (bei der wirtschaftlichen Leistung von Platz 5 auf Platz 13, bei der Unternehmenseffizienz von Platz 25 auf Platz 35, bei der Regierungseffizienz von Platz 24 auf Platz 32 und bei der Infrastruktur von Platz 11 auf Platz 20). Diese Tendenz dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen, da die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft durch steigende Energiepreise, häufige kurzzeitige Stromausfälle, eine veraltete Infrastruktur, einen zu stark regulierten Arbeitsmarkt (z.B. üppiger Kündigungsschutz), zu viel Bürokratie, hohe Steuern, überdurchschnittliche Lohnkosten und vergleichsweise hohe Fehlzeiten gefährdet ist. Beispielsweise waren die Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2024 mit durchschnittlich 43,40 Euro pro Stunde um 30% höher als der EU-Durchschnitt von 33,50 Euro. Im verarbeitenden Gewerbe kostete eine Arbeitsstunde mit 48,30 Euro 43% mehr als der EU-Durchschnitt von 33,70 Euro. Überdurchschnittlich hohe Tarifabschlüsse könnten somit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stark gefährden.
Außerdem verliert Deutschland als Investitionsstandort an Attraktivität, wird zunehmend Kapital ins Ausland exportiert. So wurden im Jahr 2022 dem Institut der deutschen Wirtschaft zufolge fast 136 Milliarden Euro im Ausland investiert, während Unternehmen aus anderen Ländern nur 10,5 Milliarden Euro in Deutschland investierten. Laut einer Allensbach-Umfrage von 2023 glauben nur 39% der Deutschen, dass Deutschland in 10 bis 15 Jahren noch zu den führenden Wirtschaftsnationen gehören wird – 2018 waren noch 59% der Befragten dieser Meinung. Anstatt die Wirtschaft zu entlasten und Zukunftsbranchen zu fördern, haben die Bundesregierungen in den letzten Jahren vor allem Sozialleistungen ausgeweitet.
Rohstoffversorgung
Ein zukünftiges Problem – insbesondere für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland – könnten schwindende Rohstoffvorkommen sein. Vor allem die Schwellenländer Asiens haben einen immer größer werdenden Bedarf an Industriematerialien wie Erze, Beton oder Asphalt. Beispielsweise wird laut dem Bergbaukonzern BHP Billiton die Gesamtkupfernachfrage von 2008 bis 2032 rund 680 Millionen Tonnen betragen – zwischen 1900 und heute wurden weltweit aber nur 608 Millionen Tonnen gefördert. Die Unternehmensberatung McKinsey schätzt, dass alleine in China 5 Milliarden Quadratmeter asphaltierter Straßen, 170 Massentransportsysteme und 5 Millionen Gebäude mit 40 Milliarden Quadratmeter Wohn- und Geschäftsfläche bis 2030 gebaut werden – mit dem entsprechenden Rohstoffbedarf.
Nach dem Jahr 2030 könnten laut dem Institut der deutschen Wirtschaft auch Rohstoffe wie z.B. Kobalt, Lithium, Graphit, Silber, Magnesium, Iridium, Nickel oder Platin knapp werden, die z.B. für Batterien, elektronische Bauteile oder die Wasserstofferzeugung benötigt werden. Dies dürfte z.B. die Produktion von E-Autos erschweren.
Je knapper die Rohstoffe werden, umso höher werden die Preise werden. Gleichzeitig wird das Recycling mit größeren Gewinnen verbunden sein. Zudem können nur auf diesem Wege die weltweit zunehmenden Müllmengen entsorgt werden. Beispielsweise lag das Abfallaufkommen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt mit 414 Millionen Tonnen im Jahr 2020 um 3% höher als im Jahr 2015. Die Verwertungsquote stieg von 79% (2015) auf 82% (2020).
Erst in mehreren Jahrzehnten werden fossile Energieträger knapp werden. Im Jahr 1960 wurden z.B. die weltweiten Erdölreserven mit gerade einmal 300 Milliarden Barrel beziffert. Seit einigen Jahren werden Erdöl und Erdgas aber zunehmend aus Tonsteinen und Ölsanden, aus der Tiefsee und aus Erdgaskondensat gewonnen – was vor 50 Jahren als unmöglich galt. Die hier eingesetzten Verfahren sind jedoch risikoreicher, sodass die Gefahr von Umweltkatastrophen steigt. Auch dürfte vermehrt in Naturschutzgebieten wie den amerikanischen Nationalparks nach Öl- und Gasvorkommen gesucht werden. Aufgrund dieser neuen Quellen wurden die Ölreserven nun seitens der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe auf 244 Gigatonnen geschätzt – bei einem weltweiten Erdölverbrauch von 4,16 Gigatonnen (2020). Hinzu kämen weitere 501 Gigatonnen an Erdölressourcen, also an derzeit technisch oder wirtschaftlich nicht förderbarem Erdöl. Die globalen Erdgasreserven wurden mit 206 Billionen Kubikmetern und die Erdgasressourcen mit 630 Billionen Kubikmetern angegeben, bei einer Jahresförderung von 3,99 Billionen Kubikmetern im Jahr 2020. Der Ukraine-Krieg zeigte aber auch, wie schnell die Energiekosten steigen können, wenn es zu (sanktionsbedingten oder auch nur erwarteten) Lieferengpässen kommt.
Nicht vor Ende des Jahrhunderts wird Kohle knapp werden, obwohl die Nachfrage seitens der Schwellenländer stark zunimmt. So entfällt laut der International Energy Agency alleine auf China mehr als die Hälfte des weltweiten Kohleverbrauchs. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe bezifferte die Reserven an Hart- und Weichbraunkohle auf 1.076 Gigatonnen und die -ressourcen sogar auf 19.870 Gigatonnen – bei einem Verbrauch von 7,65 Gigatonnen im Jahr 2020.
Die weltweite Nachfrage nach Energie wird in Zukunft weiter wachsen – insbesondere in den Schwellenländern (z.B. in China um ca. 7% pro Jahr). So ist mit Engpässen bei der Versorgung und mit steigenden Preisen zu rechnen. Auf längere Sicht sind Konflikte um die letzten Erdöl- und Erdgas-Reserven vorprogrammiert, werden die mächtigeren Staaten versuchen, möglichst viele Ressourcen für sich zu reservieren. Die Regierungen werden sich aber auch bemühen, den Verbrauch durch Effizienzstandards, Steuern oder Emissionshandelssysteme einzuschränken und erneuerbare Energien vermehrt zu nutzen.
Außerdem werden Unternehmen danach streben, Erdöl zu ersetzen – nicht nur als Heiz- und Kraftstoff (90% der derzeitigen Nutzung), sondern auch als Grundstoff für Kleidung, Kosmetik, Medizinprodukte, Plastik, Spielzeug, Computer usw. Beispielsweise enthalten rund 40% aller Textilien Erdöl. Solche Kunstfasern könnten z.B. durch Naturfasern aus Baumwolle und Hanf, aber auch durch biotechnisch hergestellt Fasern (etwa aus Milchsäure) ersetzt werden. Ferner könnten viele Ausgangsprodukte für die chemische Industrie mit Hilfe der Biotechnologie erzeugt werden, z.B. durch Bakterien- und Hefeenzyme aus organischen Abfällen. So könnte der Anteil von Bioplastik bis zum Jahr 2030 von 1% (2022) auf 15 bis 20% steigen.
Auch in der Landwirtschaft wird Erdöl eingespart werden, indem z.B. weniger Gemüse in beheizten Treibhäusern produziert wird, der Import von Erzeugnissen aus weit entfernten Ländern verringert wird und Kühlketten verkürzt werden. So dürfte die Ernährung in Zukunft saisonaler und regionaler werden. Die Transportkosten könnten sogar gänzlich eingespart werden, wenn mehr Obst, Gemüse und Salat in Städten angebaut wird – z.B. auf Dächern und Balkonen. Neben Schrebergärten werden in Deutschland „Urban-Gardening“, „Vertical-Farming“, „Indoor-Farmen“, Gemeinschaftsgärten/-äcker, solidarische Landwirtschaft und Genossenschaften von Landwirten und Verbrauchern eine immer größere Rolle spielen.
Ferner werden zunehmend erneuerbare Energien erzeugt werden. Laut dem BP Energy Outlook 2020 werden sie 2050 zwischen 40 und 60% des Energiebedarfs abdecken (nach den Rapid- und Net Zero-Szenarien) – im Jahr 2018 waren es erst 5%. Dann werden auch bis zu 85% aller PKWs und bis zu 80% aller LKWs Elektrofahrzeuge sein. Die Energiewende wird aber für die Wirtschaft mit hohen Kosten verbunden sein – zum einen bedingt durch die Einführung neuer Technologien und zum anderen durch die steigenden CO2-Abgaben, die bei der weiteren Verwendung fossiler Energieträger anfallen.
Zudem setzen viele Länder im Gegensatz zu Deutschland weiterhin auf Kernenergie, zumal bei der Produktion keine Treibhausgase entstehen. So gab es 2022 weltweit 440 Reaktoren; 53 weitere sind im Bau. Die Internationale Energieagentur (IEA) berichtete, dass 2021 fast 3 Gigawatt an atomarer Energie weniger produziert wurden, sodass weltweit insgesamt 413 Gigawatt zur Verfügung standen. Sie geht davon aus, dass die Produktion atomarer Energie auf 455 Gigawatt im Jahr 2040 zunehmen wird. Die Uranvorkommen sind jedoch begrenzt – und es gibt noch immer keine Lösung für das Problem der Atommüllentsorgung.
Einige wenige – eher pessimistisch gestimmte – Zukunftsforscher wie z.B. John Michael Greer rechnen damit, dass Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran nur sehr bedingt durch andere Energieträger ersetzt werden können. Je mehr die Förderung in den kommenden 150 Jahren zurückgehen wird – bei gleichzeitig steigender Weltbevölkerung –, umso mehr werde es zu einer De-Industrialisierung kommen, die zu einem kontinuierlich geringer werdenden Lebensstandard führen wird. Um die eigenen Ressourcen zu schützen, werden viele Länder protektionistische Maßnahmen treffen, was den Welthandel bremsen dürfte. Es käme somit zu einer Zurückentwicklung zu wenig technisierten lokalen Kulturen.