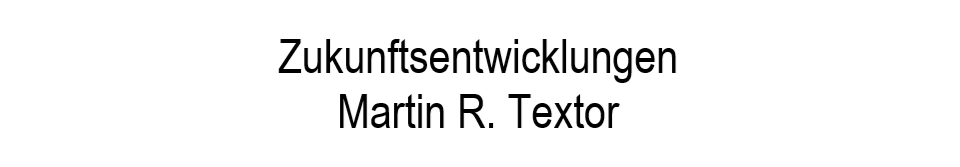Zukunftstrends: Bevölkerung
Demographischer Wandel
In den letzten Jahren ist die Bevölkerung in Deutschland gewachsen, wobei dieser Trend sich in den nächsten Jahren fortsetzen dürfte. Laut Zensus 2022 lebten 82,8 Millionen Menschen in der Bundesrepublik – beim Zensus 2011 waren es nur 80,3 Millionen gewesen.
Die Zahl der geborenen Kinder war im Jahr 2023 mit 693.019 Babys um 45.800 niedriger als im Jahr 2022. Dementsprechend sank die zusammengefasste Geburtenziffer von 1,46 auf 1,35 Kinder je Frau. Bei Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag sie bei 1,26 und bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit bei 1,74. Das Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt des ersten Kindes war mit 30,3 Jahren um 1,5 Jahre höher als im Jahr 2009; die Väter waren 33,2 Jahre alt. Im Jahr 2023 starben 1.027.916 Menschen; 2017 waren es nur 932.272 Personen gewesen. Seit 1972 sterben jedes Jahr mehr Menschen als Kinder geboren werden. Im Jahr 2023 lag die Differenz bei 334.897 Personen.
So beruht der Bevölkerungszuwachs ausschließlich auf der Migration: Im Jahr 2023 sind laut Statistischem Bundesamt 662.964 Personen mehr nach Deutschland zugezogen als aus Deutschland fortzogen. 2016 hatte der Wanderungsüberschuss erst 499.944 Menschen betragen. Nur 191.356 Zuwanderer hatten einen deutschen Pass; 581.088 kamen aus EU27-Staaten und 1.160.065 aus weiter entfernten Ländern.
Dementsprechend steigt in Deutschland die Zahl der Ausländer bzw. die Zahl der Menschen mit einem Migrationshintergrund: Ende 2022 lebten 13.383.910 Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft in Deutschland (15,9% der Gesamtbevölkerung) – 4.276.015 Personen mehr als 2015. Insgesamt 23,8 Millionen Menschen und somit 28,7% der Bevölkerung in Deutschland hatten einen Migrationshintergrund – im Jahr 2017 waren es nur 24,8%. Rund 62% aller Personen mit Migrationshintergrund sind aus einem anderen europäischen Land Eingewanderte oder deren Nachkommen, 24% stammten aus Asien (insbesondere aus dem Nahen und Mittleren Osten) und 5% aus Afrika.
Laut den neun Hauptvarianten der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Basis: Jahr 2021) wird die Bevölkerung im Jahr 2040 zwischen 81,6 und 87,9 Millionen Menschen und 2060 zwischen 76,1 und 89,2 Millionen Menschen umfassen. Fünf der neun Varianten gehen von einem Bevölkerungsrückgang bis 2060, zwei von einer konstanten Bevölkerungsgröße und zwei von einem Bevölkerungswachstum aus. Die neun Prognosen unterscheiden sich nach Vorannahmen hinsichtlich der Geburtenhäufigkeit, der Lebenserwartung und insbesondere des Wanderungssaldos. Im Folgenden wird von der Hauptvariante 2 ausgegangen, die mit einer Bevölkerungsvorausberechnung von 84,9 Millionen Menschen für 2040 und 82,9 Millionen für 2060 in der Mitte der vorgenannten Prognosen liegt. Hier wurde von einer Geburtenrate von 1,55 Kindern je Frau, einer Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2060 von 84,6 Jahren bei Jungen und 88,2 Jahren bei Mädchen sowie von einem Rückgang der jährlichen Nettozuwanderung von 1,3 Millionen Personen im Jahr 2022 auf 250.000 im Jahr 2033 ausgegangen (danach konstant 250.000 Menschen pro Jahr).
Der größte Unsicherheitsfaktor bei Bevölkerungsprognosen liegt in den Annahmen zur jährlichen Nettozuwanderung. So will die deutsche Wirtschaft in den kommenden Jahren mehr Fachkräfte im Ausland anwerben, um den bereits spürbaren Arbeitskräftemangel zu kompensieren (zurückgehende Zahl der Menschen im Erwerbsalter). Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die Zahl der Asylbewerber. So schwankte die Zahl der Asylerstanträge in den letzten Jahren zwischen 722.370 im Jahr 2016 und 102.581 im Jahr 2020. Im Jahr 2023 gab es 329.120 Erstanträge. Das Statistische Bundesamt vermeldete, dass Ende 2023 rund 522.700 Personen Asylbewerberleistungen erhielten – 36.600 Menschen mehr als im Vorjahr. Ferner flüchteten rund 1,19 Millionen Ukrainer nach Deutschland. Wie lange sie bleiben werden, wird von dem weiteren Verlauf des Krieges mit Russland abhängen. Insgesamt lebten Ende 2023 laut Statistischem Bundesamt circa 3,17 Millionen Menschen als Schutzsuchende in Deutschland – 2013 waren es nur 614.000 Personen.
In den kommenden Jahren werden noch viele Ausländer zuwandern, da für Deutschland mehr Wirtschaftswachstum als für andere EU-Staaten erwartet wird, die politische und wirtschaftliche Situation in vielen vorderasiatischen und afrikanischen Ländern angespannt bleiben dürfte und mit mehr Klimaflüchtlingen zu rechnen ist. Dies wird zu einem weiter wachsenden Bedarf an Wohnungen führen – er wird laut dem Zentralen Immobilien Ausschuss von 600.000 im Jahr 2024 auf 830.000 im Jahr 2027 ansteigen. Im Jahr 2023 wurden nur 294.400 Wohnungen fertig gestellt. Wegen der hohen Baukosten werde laut dem Ifo-Institut die Zahl neuer Wohnungen bis auf 175.000 im Jahr 2026 sinken. Asylanten und Flüchtlinge werden weiterhin hohe Kosten verursachen, die eine rasch alternde Gesellschaft immer schwerer aufbringen kann. Auch könnte der wachsende Anteil von Migranten an der Bevölkerung zu mehr Fremdenfeindlichkeit und Konflikten mit Deutschen führen.
Regionale Bevölkerungsentwicklung
Im Jahr 2022 lebten laut Statistischem Bundesamt 68,0 Millionen Personen (84,4%) im früheren Bundesgebiet (ohne Westberlin); 12,6 Millionen Personen (15,6%) wohnten in den neuen Ländern (ohne Ostberlin). In Westdeutschland lebten rund 2,6 Millionen Menschen mehr als 2010; in Ostdeutschland hat die Einwohnerzahl um 0,3 Millionen Personen abgenommen (ohne Berlin).
Viele ländliche Regionen – insbesondere abseits der Ballungsräume – erleben schon seit Jahren einen Bevölkerungsrückgang, der sich auch in absehbarer Zeit fortsetzen dürfte. Dies führt zu fallenden Immobilienpreisen – viele Mietwohnungen werden leer stehen oder abgerissen werden, Eigenheime und Eigentumswohnungen werden immer schwerer und zumeist nur mit Verlust verkauft werden können. So werden dort lebende Menschen niedrigere Mieten als heute zahlen bzw. preisgünstiger Wohneigentum erwerben können. Allerdings werden in diesen Regionen zunehmend Infrastruktur- und Dienstleistungen reduziert, während gleichzeitig die Versorgungsgebühren ansteigen, da die Anlagen nicht mehr ausgelastet sind und weniger Einwohner für Reparaturen und Ersatzinvestitionen aufkommen. Zudem sind viele Orte schon jetzt nicht mehr an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden, was z.B. für Senioren, die nicht mehr Auto fahren können, ein großes Problem darstellt.
Hingegen werden Großstädte wie z.B. Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, Hannover und Berlin mitsamt dem Umland, Ferienregionen und weite Teile des südlichen und nordwestlichen Raums in den nächsten Jahren eine weitere Bevölkerungszunahme erfahren. Hier wandern jüngere, besser qualifizierte Menschen zu, und so werden Unternehmen vor allem in diesen Wachstumszentren neue Arbeitsplätze schaffen (Aufwärtsspirale). Allerdings werden die Lebenshaltungskosten weit über dem Durchschnitt liegen. Auch die Immobilienpreise und Mieten werden weiterhin hoch bleiben oder sogar noch steigen. Allein in Bayern besteht nach einer Prognose des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein Neubaubedarf von 46.600 Wohnungen pro Jahr für den Zeitraum 2021 bis 2025 und von 39.600 Wohnungen je Jahr für 2026 bis 2030. Diese Regionen werden weiterhin mit Straßen und Schienen unterversorgt sein, sodass hier hohe Staukosten entstehen.
Da die Berufsaussichten, die Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Versorgung und die Freizeitangebote in den Städten besser sind, wird die Urbanisierung weiter zunehmen. Zudem ziehen mehr Senioren in die Städte zurück, während für viele junge Paare das „Eigenheim im Grünen“ nicht mehr die ideale Wohnform ist, weil sie beruflich mobil bleiben wollen und für sie die Vorteile des Stadtlebens überwiegen – selbst nach der Familiengründung (z.B. bessere Kinderbetreuungsangebote, mehr Schulformen, kürzere Wege zum Arbeitsplatz).
Aufgrund der zunehmenden Aufspaltung des Arbeitsmarktes in sehr gut und eher schlecht Verdienende werden auch die Städte „bipolar“ werden: Es wird einerseits reiche Stadtteile sowie andererseits arme Viertel und soziale Brennpunkte geben. Vermutlich werden sich deutsche und ethnische Quartiere mit schon jetzt drastisch unterschiedlichen Lebensbedingungen noch stärker voneinander abgrenzen. Menschen mit Migrationshintergrund werden auch in Zukunft eher in Städten leben, häufiger in Miethaushalten wohnen und über weniger Wohnraum – mit einer schlechteren Ausstattung (z.B. im technischen Bereich) – verfügen als Deutsche. Die Bildungschancen ihrer Kinder werden sich aufgrund besonderer Förderprogramme verbessern, aber vor allem bei Zugehörigkeit zur Unterschicht weiterhin unterdurchschnittlich sein. Kinder mit Migrationshintergrund werden aufgrund der sozialräumlichen Polarisierung der Wohnviertel auch andere Kindertageseinrichtungen und (Grund-) Schulen besuchen als Kinder aus der Mittelschicht.
Alterung der Bevölkerung
In den kommenden Jahrzehnten wird sich die Altersstruktur der Gesellschaft stark verändern. Laut Variante 2 der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (s.o.) waren 62% der Bevölkerung im Jahr 2021 im Erwerbsalter von 20 bis 66 Jahren. Ihr Anteil wird auf 57% im Jahr 2040 bzw. 56% im Jahr 2070 zurückgehen. Der Anteil von Menschen unter 20 Jahren wird konstant bei 19% der Bevölkerung liegen (Prognosen für 2040 und 2070). Hingegen wird die Zahl der 67-Jährigen und Älteren stark ansteigen, weil nach 2020 die geburtenstarken Jahrgänge in dieses Alter kommen werden. Ihr Anteil wird von 19% der Bevölkerung im Jahr 2021 auf 25% im Jahr 2040 bzw. 26% im Jahr 2070 zunehmen. Im letztgenannten Jahr werden 11% der Menschen sogar 80 Jahre oder älter sein.
Bedenkt man die hohe Lebenserwartung und den guten Gesundheitszustand vieler Senioren, so ist nicht verwunderlich, dass sich 58% der 65- bis 85-Jährigen laut der Generali Altersstudie von 2017 nicht als „alte Menschen“ bezeichneten. Rund 46% der 65- bis 69-Jährigen verbanden das Alter vor allem mit neuen Chancen – bei den 70- bis 74-Jährigen waren es noch 41%. Die meisten Senioren führen ein aktives Leben: Sie verbringen z.B. viel Zeit mit ihren Hobbys sowie mit ihren Kindern und Enkeln, sind viel mit dem eigenen Auto unterwegs und nutzen zunehmend das Internet. Außerdem sind 42% der 65- bis 85-Jährigen ehrenamtlich tätig. Die meisten Senioren sind laut der Umfrage mit ihrer materiellen Situation, ihrer Wohnsituation und ihrem Leben zufrieden. In den kommenden Jahren wird sich die Gruppe der über 65-Jährigen weiter aufspalten: In „junge Senioren“, „rüstig Gebliebene“ und „Hochbetagte“ – mit ganz unterschiedlichen Lebensstilen und -umständen.
Mit der Alterung der Bevölkerung wird der Altenquotient – die Anzahl der Menschen im Rentenalter je 100 Personen im Erwerbsalter – erheblich zunehmen. Im Jahr 2021 kamen laut der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 32 Senioren im Alter von 67 Jahren und mehr auf 100 Personen zwischen 20 und 66 Jahren. Ihre Zahl wird auf 41 bis 46 Personen im Jahr 2040 und auf 39 bis 56 Personen im Jahr 2070 ansteigen (je nach einer der neun Hauptvarianten). Im Jahr 2021 mussten 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter für 32 Senioren aufkommen. Es ist offensichtlich, dass sie schon 2040 nicht im gleichen Maße wie heute für dann 41 bis 46 Senioren sorgen können – geschweige denn 2070 für bis zu 56 alte Menschen. Es kommt also in jedem Fall eine große Belastung auf den erwerbsfähigen Bevölkerungsteil zu. Wenn man bedenkt, dass nicht alle Menschen zwischen 20 und 66 Jahren voll erwerbstätig sind, sondern manche noch eine Ausbildung machen oder studieren, andere arbeitslos sind oder nur wenig verdienen, und wieder andere sich in der Familienphase befinden, dann geht die Tendenz dahin, dass Mitte dieses Jahrhunderts ein Arbeitnehmer fast alleine für einen Rentner aufkommen müsste.
Dies ist natürlich nicht möglich. So ist es in den kommenden Jahrzehnten unausweichlich, dass Menschen weit über ihr 65. Lebensjahr hinaus arbeiten müssen – es wird nicht länger möglich sein, dass Senioren wie 2021 im Durchschnitt 18,5 Jahre lang Rente beziehen, und Seniorinnen sogar 22,0 Jahre lang. Laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) müsste deshalb das Renteneintrittsalter weiter erhöht werden: bis 2030 auf 69 Jahre und bis 2041 auf 73 Jahre. Freiwillig arbeiteten im Jahr 2023 dem Statistischen Bundesamt zufolge bereits rund 13% aller Rentner zwischen 65 und 74 Jahren.
Dennoch wird die Rente für viele Senioren – insbesondere solche, die während ihrer Erwerbstätigkeit wenig verdient haben oder längere Zeit arbeitslos waren – nicht mehr ausreichen. Laut Recherchen des Westdeutschen Rundfunks werden im Jahr 2030 fast 50% der Menschen, die in den Ruhestand eintreten, eine Rente erhalten, die nicht über dem Hartz IV-Niveau liegen wird. Um dies zu vermeiden, haben Bundestag und Bundesrat die Grundrente verabschiedet, die ab Januar 2021 an 1,3 Millionen Rentner ausgezahlt wird.
Allerdings hatten laut Statistischem Bundesamt 4,9 Millionen Rentner im Jahr 2021 ein persönliches monatliches Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro (38,2% der Rentnerinnen und 14,7% der Rentner). Dem Paritätischen Armutsbericht 2022 zufolge waren 3,24 Millionen Rentner von Altersarmut betroffen. Dementsprechend waren Ende 2024 laut Statistischem Bundesamt 739.000 alte Menschen auf soziale Grundsicherung angewiesen. Viele Senioren hatten sich auch einen Nebenverdienst gesucht: Beispielsweise hatten Ende 2024 laut Minijob-Zentrale 1.233.000 Menschen, die älter als 65 Jahre waren, einen Minijob. Mehrere Hunderttausend Rentner sind auf die Tafeln hinsichtlich ihrer Versorgung mit Lebensmitteln angewiesen – mit weiter steigender Tendenz (laut Trägerverein Tafel Deutschland). Wer nicht privat vorgesorgt hat oder über Vermögen verfügt, wird sich in Zukunft mit einem geringeren Lebensstandard abfinden müssen.
Aber auch Vermögende werden unter Umständen feststellen, dass sie für ihre Aktien und Immobilien weniger als erwartet bekommen, da es mehr Verkäufer als Käufer geben könnte – was die Preise drücken würde. So ist es nicht verwunderlich, dass sich laut dem Institut für Demoskopie Allensbach bereits 55% der Deutschen Sorgen machen, dass sie ihren Lebensstandard im Alter nicht halten können. Besonders problematisch könnte in Zukunft die Situation von älteren Menschen mit niedrigen Renten sein, die von Behinderung, psychischer Erkrankung oder Demenz betroffen – also pflegebedürftig – sind, da hier zusätzliche Kosten entstehen.
Wie hoch die Renten in Zukunft sein werden, wird weitgehend von der Wirtschaftsentwicklung abhängen. Verläuft sie positiv, könnten nahezu alle Menschen im erwerbsfähigen Alter berufstätig sein, also Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Selbst dann werden laut einer Prognos-Studie schon im Jahr 2030 die Rentenversicherungsbeiträge auf 22,0% und 2040 auf 23,8% steigen – und die Beiträge für Krankenkassen und Pflegeversicherung auf 20,6% bzw. 22,9%. Die Corona-Pandemie und die durch sie ausgelöste Wirtschaftskrise dürften diese Entwicklung noch beschleunigen: So sinken z.B. die Einnahmen der Rentenversicherung, was laut einer Studie des Ifo-Instituts dazu führen könnte, dass hinsichtlich des Beitragssatzes die bis 2025 festgelegte Haltelinie von 20% bereits 2021 erreicht wird. Zwischen 2026 und 2035 könnte dann der Rentenversicherungsbeitrag auf bis zu 24% ansteigen.
Hinzu kommt, dass aufgrund der zurückgehenden Zahl der Erwerbstätigen auch die Steuereinnahmen sinken dürften. So geht das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln davon aus, dass z.B. das Einkommensteueraufkommen – gemessen in heutigen Preisen – von 281 Milliarden Euro im Jahr 2016 auf 263 Milliarden Euro im Jahr 2035 abnehmen wird. Im gleichen Zeitraum dürften die Sozialbeiträge von 330 auf 322 Milliarden Euro sinken. Sollten die Staatsausgaben steigen – z.B. wegen höherer Zuschüsse zu den Sozialversicherungen oder einer wachsenden Zahl von Sozialhilfe- und Bürgergeldempfängern sowie Arbeitslosen – könnten Steuererhöhungen zum Ausgleich des Defizits nötig werden.
So werden die Menschen ab 2020 weniger Geld für den Konsum haben: Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung könnten die Konsumausgaben 2050 mit 935 Milliarden Euro unter dem heutigen Niveau liegen. Damit wird die innerdeutsche Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinken. Die Unternehmen werden die steigenden Sozialversicherungsbeiträge in die Preise hinein rechnen müssen, was den Export in außereuropäische Länder erschweren dürfte. Die zurückgehende Nachfrage, sinkende Investitionen sowie die mangels junger, kreativer Arbeitskräfte geringere Innovationsfähigkeit und kaum noch wachsende Produktivität könnten dazu führen, dass viele Unternehmen abwandern und die Wirtschaft stagniert oder sogar schrumpft.
Krankheiten und Pflegebedürftigkeit
Die Alterung der deutschen Bevölkerung wird laut Fritz Beske, Direktor des Instituts für Gesundheits-System-Forschung in Kiel, dazu führen, dass bis 2050 die Zahl der Menschen mit Lungenentzündung um 149%, mit altersbedingter Makuladegeneration um 125%, mit Demenz um 104%, mit Oberschenkelhalsfrakturen um 88%, mit Herzinfarkt um 75%, mit Schlaganfall um 62%, mit Krebs um 27%, mit Osteoporose um 26% und mit Diabetes mellitus um 22% gegenüber dem Jahr 2007 ansteigen wird. So gehen Schätzungen davon aus, dass die Zahl der Belegungstage in Krankenhäusern zwischen 2009 und 2030 um 13% zunehmen wird.
Dementsprechend ist mit höheren Kosten im Gesundheitswesen zu rechnen. Für Menschen, die 65 Jahre alt und älter sind, musste eine Krankenkasse wie die Barmer 2019 mehr als 6.600 Euro aufbringen, für 18- bis 24-Jährige hingegen nur knapp 1.600 Euro und für 40- bis 44-Jährige knapp 2.500 Euro. Da die Zahl der Rentner rasant zunehmen wird, müsste der Beitragssatz laut der Deutschen Aktuarvereinigung von derzeit 15,6% bis 2060 auf knapp 25% ansteigen, falls alle die gleichen Leistungen wie heute beanspruchen. Dies wird für die Arbeitnehmer nicht akzeptabel sein, da sie – wie bereits erwähnt – auch mehr Rentenversicherungsbeiträge zahlen müssen. So werden die Leistungen der Krankenkassen wahrscheinlich reduziert werden.
Die Alterung der Gesellschaft wird zu einem rasch wachsenden Bedarf an sozialen Einrichtungen und Diensten für ältere und hochbetagte Menschen führen – an Begegnungs-, Freizeit-, Kultur-, Service- und Beratungsstellen. So ist die Zahl der Pflegebedürftigen bereits von 2,5 Millionen im Jahr 2013 auf knapp 5,7 Millionen zum Jahresende 2023 angestiegen. Laut Pflegereport der Barmer Krankenkasse wird sie auf 6 Millionen im Jahr 2030 und 7 bis 8 Millionen im Jahr 2050 zunehmen – wobei Pflegebedürftigkeit im Durchschnitt 7,5 Jahre dauert. Viele Pflegebedürftige werden auf öffentliche Unterstützung angewiesen sein, da immer häufiger Partner oder erwachsene Kinder fehlen werden, die bisher in zwei Dritteln der Fälle die Pflege übernahmen. In Zukunft werden Kinder auch häufiger an weit entfernten Orten wohnen oder Vollzeit erwerbstätig sein. Dementsprechend werden mehr geriatrische und gerontopsychiatrische Abteilungen in Krankenhäusern, mehr Alten- und Pflegeheime, mehr Tages- und Kurzzeitpflegeplätze sowie mehr ambulante pflegerische, hauswirtschaftliche und Mahlzeitendienste benötigt werden. Laut dem Pflegeheim-Atlas Deutschland 2021 werden bis 2035 rund 157.000 zusätzliche Pflegeheimplätze benötigt. Bis 2030, so eine Bertelsmann-Studie, werden 500.000 Pflegekräfte fehlen.
In den kommenden Jahren müssen sich Pflegeheime und ambulante Dienste zunehmend für Menschen mit Migrationshintergrund öffnen – selbst wenn ältere Migranten häufiger als deutsche Seniornen mit jüngeren Familienangehörigen zusammenleben und von diesen im Bedarfsfall gepflegt werden. Im Jahr 2030 wird jeder Vierte der über 60-Jährigen in Deutschland ein Einwanderer sein – die meisten von ihnen Muslime. Werden sie pflegebedürftig und können nicht von Verwandten versorgt werden, muss die Altenpflege für sie besondere Konzepte entwickeln (z.B. Lamm statt Schwein beim Mittagessen oder ein eigener Gebetsraum im Heim mit der Möglichkeit für rituelle Waschungen). Auch müssen Pfleger ausgebildet werden, die Sprache und Kultur der Muslime kennen. Hier könnte auf Personen mit einem entsprechenden Migrationshintergrund zurückgegriffen werden.
Bei der skizzierten Entwicklung ist damit zu rechnen, dass auch die Pflegeversicherung schon bald an ihre Grenzen stoßen wird – zumal die Zahl der Beitragszahler im Jahr 2050 um ein Drittel kleiner sein wird als heute. Die Ausgaben für Pflege werden laut einem Gutachten von Professor Reinhold Schnabel, Universität Duisburg-Essen, im Jahr 2030 bei nahezu 48 Milliarden Euro liegen, von denen die gesetzliche Pflegeversicherung lediglich 32 Milliarden Euro übernehmen wird. Die übrigen Kosten müssen privat oder von den Kommunen aufgebracht werden. Dementsprechend werden sich diese Selbstbeteiligungs- und Sozialhilfeausgaben bis zum Jahr 2050 verfünffachen. Zugleich müsste der Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung laut der Deutschen Aktuarvereinigung bis 2060 auf bis zu 8,5% steigen.